|
Johann Georg Theodor Grässe (* 31. Januar 1814; † 27. August 1885) studierte ab 1833 Philologie sowie Philosophie und Archäologie an der Universität Leipzig, wo er 1834 promoviert wurde. 1855 erschien als eines seiner Hauptwerke auf dem Gebiet der Sagen „Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen mit etwa 1000 Sagen. 1868/1871 erschien das „Sagenbuch des Preußischen Staates“ mit 2206 Sagen, Nachweise der älteren literarischen Quellen, teilweise auch mit der Angabe Mündlich.
Der historische und in Fraktur gedruckte Text dieser Sagen aus der Grafschaft Glatz wurde in moderne Schrift übertragen und bereitgestellt von Christian Drescher.
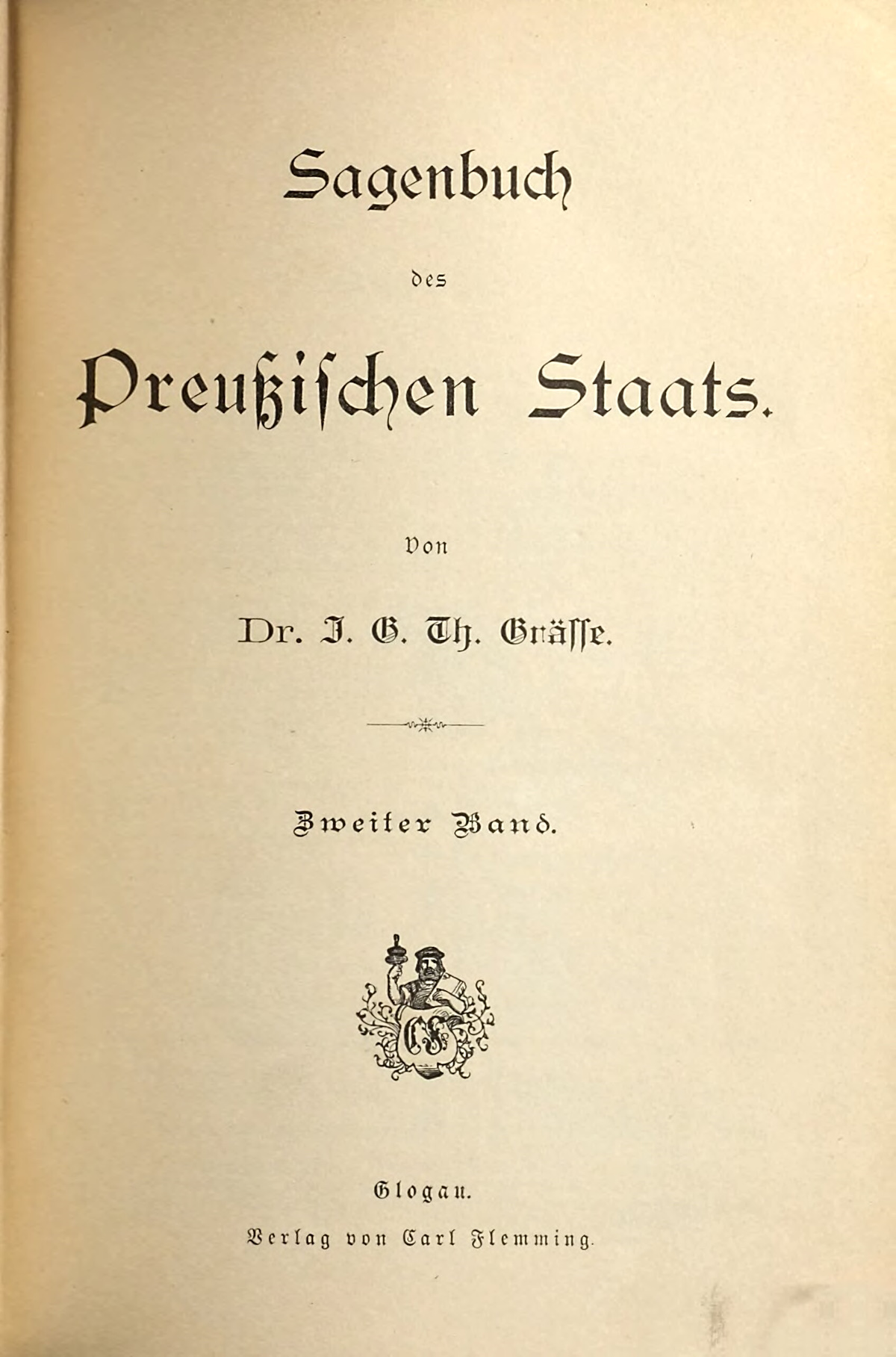 Titel des Buches von 1871
Titel des Buches von 1871Inhaltsverzeichnis
(S. Wedekind, Geschichte der Grafschaft Glatz. Neurode 1857, S. 141.)
Ueber den Ursprung des Namens der Stadt Glatz giebt es verschiedene
Sagen. Die eine berichtet, Glatz habe ursprünglich Luca geheißen und dieser
Name sei dem Orte Glatz von dem ersten Gründer gegeben worden, der
Luca geheißen habe und über ein Fähnlein Volk ein berühmter römischer
Hauptmann gewesen sei. Nach einer andern Sage hätte die Stadt ihren
Namen von dem lateinischen Worte glacies (Eis), denn wenn man zur
Winterszeit dahin gekommen ist, so soll die Stadt, da sie noch, wie damals
gebräuchlich war, ganz niedere Häuser hatte, auf lauter Eis zu stehen
geschienen haben. Andere erzählen, an der Stelle, wo jetzt Glatz stehe, habe
Heinrich der Finkler einen Hunnenobersten, Glotz genannt, erlegt und zum
Andenken habe der Kaiser der Stadt den Namen Glotz, woraus dann Glatz
geworden, gegeben.
In frühern Zeiten hing am Rathhause, der Taberne gegenüber, in
freier Luft ein Klotz und dieser galt als Wahrzeichen derselben. Desgleichen
war unter dem böhmischen Thore in der Mauer ein Klotz aus Stein
ausgehauen und eingemauert und auch dieser galt als Wahrzeichen. Seine
Bedeutung wird aber daraus erklärt, daß Glatz, ehe es ein Marktflecken
ward, ein Ort von lauter Busch und Wald war. Als sich nun Menschen
hier ansiedelten und die Bäume meistens ausgerodet wurden, hat außen auf
dem jetzigen Markte ein großer Eichenklotz gestanden. Wenn nun die Leute
aus den benachbarten Dörfern oder Flecken dahin reisen wollten, so sagten
sie: „Wir wollen zum Klotz!“ und davon hat die Stadt ihren Namen erhalten.
In uralten Zeiten soll zur Heidenzeit eine heidnische Jungfrau das
Land Glatz regiert haben, allein in eitler Wollust, Ueppigkeit und Unzucht
gelebt und sich der gräulichsten Zauberei beflissen haben. Sie war so
kriegerisch und gewandt, daß sie mit ihrem Bogen und Pfeilen bis zu der
großen Linde bei Eisersdorf an der Grenze des Glatzer Kreises (1 Meile
südöstlich von Glatz an der Landecker Straße) schießen konnte. So wettete
sie einstmals mit ihrem Bruder um einen hohen Preis, wer mit dem Bogen
den Pfeil am weitesten treiben werde, ihr Bruder erreichte kaum den halben
Weg, sie aber trieb ihren Pfeil vom Schlosse zu Glatz fast noch einmal so
weit, nämlich bis zu der vorerwähnten großen Linde bei Eisersdorf, und
gewann die Wette.
Diese Jungfrau hat nicht blos mit vielen Andern, sondern mit ihrem
eigenen Bruder abscheuliche Unzucht getrieben, weshalb man ihr fleißig
nachstellte, um sie gebührlich zu bestrafen. Von ihrer Zauberei war aber das
ein Zeichen, daß sie starke Hufeisen mit den Händen zur Kurzweil zerbrach,
ihren Zauberkünsten wegen gelang es aber nicht, ihrer habhaft zu werden,
weil sie immer wieder entrann. Endlich glückte dies doch und nun soll sie
in einem großen Saale am Thore, zwischen dem Ober- und Niederschlosse
fest vermauert und darin umgekommen sein. Zum ewigen Gedächtniß dieser
Begebenheit hat man an der Mauer über dem tiefsten Graben ihr Bildniß,
das aus einem Stein ausgehauen war, eingemauert. Diesen ausgehauenen
und eingemauerten Stein hat man bis ins 17. Jhdt. hinein allen Fremden
gezeigt, die das Schloß zu Glatz besuchten. Sonst stand auch ihr Bild,
schön und sauber gemalt, in dem sogenannten grünen Saale des Schlosses
zu Glatz. An der Stelle der sogenannten Petri- oder Peter-Pauls-Kirche
auf dem Oberschlosse hat bis ums Jahr 936, wo jene erbaut ward, ein
Götzentempel, das sogenannte heidnische Kirchlein gestanden, aus dieser ward
ein Götzenbild lange in der Burg zum Andenken aufbewahrt, kam aber im
Jahre 1743 mit einer Trommel *), dem Bogen und dem goldenen Haar
jener heidnischen Jungfrau (Valeska *), welches bis zum Jahre 1622
den Besuchern jenes Kirchleins hoch an der Wand an einem Nagel hängend
gezeigt ward, nach Berlin in die Kunstkammer.
Man erzählt nun, daß sich diese Jungfrau in ihrer alten Kleidung noch
oft auf dem Schlosse zu Glatz sehen läßt, sie thut aber Niemandem etwas
zu Leide, wenn man sie zufrieden läßt und nicht hämisch von ihr spricht.
Ein Soldat, der dies einst that, als er auf dem Posten stand, erhielt auf
einmal von ihrer eiskalten Hand einen gewaltigen Backenstreich. Im Jahre
1621 ward der Geistliche Aelurius zu einem Soldaten gerufen, um ihm
das h. Abendmahl zu geben, derselbe war im Gesicht sehr übel zugerichtet
und sagte auf das Befragen des Geistlichen, wo dies herrühre, er hätte das
Haar der heidnischen Jungfrau aus dem Kirchlein weggenommen, worauf
sie in der Nacht zu ihm gekommen sei und ihn schrecklich gemißhandelt habe,
wahrscheinlich würde sie ihn umgebracht haben, hätte nicht einer seiner
Kameraden auf sein Bitten das Haar wieder in das Kirchlein zurückgetragen
und dort aufgehängt.
*) Nach Andern wäre dies die Trommel, welche mit der abgezogenen Haut des
Hussitengenerals Ziska überspannt war
Die große Linde bei Eisersdorf soll so alt gewesen sein, als der
heidnische Thurm daselbst. Obwohl sie mehrmals verdorrte, ist sie doch immer
wieder von Neuem gewachsen. Einstmals soll sich die erwähnte Zauberin
darauf gesetzt und von der Stadt Glatz viele zukünftige Dinge geweissagt
haben. Unter andern hat sie gesagt, der Türke werde einst bis Glatz kommen
und allda, wenn er durch die steinerne Brücke hinauf bis auf den Ring
kommen werde, eine große Niederlage erleiden, weil ihm die Christen aus
dem Schlosse herunter entgegenziehen und ihn auf dem Markte erlegen
würden. Solches aber werde nicht eher geschehen, als bis eine ganze Schaar
Kraniche durch die Brotbänke geflogen sein würden. Bis jetzt ist aber
diese Prophezeihung noch nicht in Erfüllung gegangen.
(S. Aelurius, Chronik von Glatz S. 236 c.)
Im Jahre 1345 hat sich in dem Städtlein Lewin eine schreckliche
Historie zugetragen. Es war darin ein Töpfer mit Namen Duchacz, welcher
ein Weib hatte, die hieß Brodke und war voll teuflischer Zauberei. Als
dieses bekannt wurde, ermahnten sie die Priester, von solchem bösen Thun
abzustehen. Da begab es sich plötzlich, als sie ihre Geister zusammengerufen,
daß sie eines plötzlichen Todes verstarb. Niemand wußte zu sagen,
ob sie von bösen Geistern umgebracht oder sonst gestorben sei. Deshalb
wollte man sie unter frommen Christen nicht begraben, sondern verscharrte
sie an einem Scheidewege. Bald wurde jedoch verspürt, daß sie umging,
zu den Hirten auf dem Felde kam, sich in allerlei Thiergestalten verwandelte,
die Hirten erschreckte, das Vieh verjagte und nicht wenig Bekümmerniß ver
ursachte. Bisweilen ließ sie sich auch noch in ihrer Gestalt, als sie lebte,
sehen, kam so ins Städtchen Lewin und in die Dörfer, in der Leute Häuser
unter mancherlei Gestalten, redete mit den Leuten, erschreckte sie und brachte
manche sogar ums Leben. Da vereinigten sich die Bürger und Bauern,
ließen die Leiche durch einen hierzu tüchtigen Mann ausgraben; nun konnten
alle anwesenden Menschen sehen, daß sie die Hälfte des Schleiers, den sie
auf dem Kopfe gehabt, in sich hinein gewürgt hatte; derselbe wurde ihr ganz
blutig aus dem Halse gezogen. Hierauf ließ man ihr zwischen die Brust
einen eisernen Pfahl schlagen, bald floß ihr Blut aus dem Leibe, nicht
anders als aus einem Rinde, daß sich Alle verwunderten und dann ward
sie wieder verscharrt. Aber nach kurzer Zeit ließ sie sich wieder sehen und
öfters als zuvor, erschreckte und tödtete die Menschen und sprang mit
den Füßen auf den Leichen umher. Deshalb wurde sie durch denselben
Mann noch einmal ausgegraben und befunden, daß sie den eichenen Pfahl
aus dem Leibe gezogen hatte und in den Händen hielt. Hierauf wurde sie
sammt dem Pfahle verbrannt und die Asche im Grabe verscharrt. Zwar
sah man an der Stelle nach etlichen Tagen einen schrecklichen Wirbelwind,
die Hexe aber kam nie wieder.
**) Aelurius sagt, er wisse nicht ob diese Jungfrau die Königin Libussa, oder die
Polin Velda, oder die böhmische Zauberin Vauska.gewesen sei.
(S. Wedekind, Gesch. d. Grafschaft Glatz S. 196)
In Glatz befand sich früher eine große steinerne Säule, welche sich
darauf bezog, daß die Juden aus der Stadt Glatz für ewige Zeiten
verwiesen wurden, weil sie viele Lästerungen gegen den Sohn Gottes und
seine Mutter, die h. Jungfrau Maria, desgleichen auch über die heiligen
Sacramente des Neuen Testamentes ausschütteten. Namentlich haben sie
im Jahre 1492 in Glatz ein altes Weib heimlich mit Geld und guten
Worten dahin gebracht, daß sie die gesegnete Hostie, wenn sie communiciren
würde, heimlich verstecken und ihnen bringen sollte, damit sie vielleicht nachher
ihre Zauberei und Gaukelei mit derselben ausüben könnten. Als nun das
Weib zum Tische des Herrn ging, hat sie das gesegnete Brod im Munde
behalten und in einen Aermel fallen lassen, ist hernach hingegangen und hat
es den Juden verkaufen wollen. Wie sie aber auf die Böhmische Gasse
gekommen, hat sie es auf die Erde fallen lassen, welches eine Magd aufgehoben
und dem Rathe soll angezeigt haben. Ein wohlweiser Rath der Stadt
Glatz hat alsbald das schuldige Weib mit Gefängniß einziehen lassen und
dieselbe hat auch die böse That ohne Verzug bekannt, darnach ist sie mit
Zangen zerrissen und verbrannt worden. Bald darauf sind auch alle Juden
aus Glatz vertrieben und es ist in demselben Jahre 1492 auf der Böhmischen
Gasse auf derselben Stelle, wo sich die Begebenheit zugetragen, eine große
steinerne Säule aufgerichtet worden. Später hat man die Säule verrückt,
da sie im Wege hinderlich war, und an die Giebelwand des nächsten Hauses
gesetzt und eingemauert, so daß man sie noch jetzt mit den ausgehauenen
Figuren wohl erkennen kann.
(S. Aelurius S. 314.)
Ein Mörder und Straßenräuber hatte nicht weit von Jägerndorf einen
reichen Kaufmann aus Neisse ermordet und 3000 ungarische Dukaten bei
ihm gefunden, welches Geld er sammt dem Pferde an sich genommen, den
Leichnam aber heimlich verscharrt hatte. Nach einiger Zeit sitzt er in einem
vornehmen Wirthshause zu Glatz, in welchem viele gelehrte Leute über Tisch
von seltsamen Händeln und Begebenheiten, und auch von der Menschen
Nativität reden, dabei auch vieler Exempel gedacht wird, wie manchem Menschen
aus seiner Nativität seine Zukunft, ja auch sein Lebensende sei verkündet
worden. Gedachter Mörder, der zwar von seinem Vorhaben abgestanden
war – Peter Klimpt war sein Name –, nimmt solches in Acht und geht
am folgenden Morgen zu einem hocherfahrenen Astrologen in Glatz, den er
deswegen schon hatte rühmen hören, verehrt ihm fünf Dukaten und giebt
ihm daneben die Stunde seiner Geburt, wie er sie von seinen Eltern erfahren,
an. Gedachter Astrolog bescheidet ihn auf den folgenden Morgen wieder zu
sich und will ihm dann das Geld wiedergeben, indem er sagt, er könne in
dieser Sache nicht richten. Gedachter Klimpt spricht, er solle das Geld behalten
und ihm gerade Alles heraussagen. Da spricht der Astrologus:
„Weil Ihr es ja wissen wollt, so will ich es Euch anzeigen, doch wisset
dieses zuvor: Astra non necessitant sed tantum inclinant. Ich finde aber,
daß Ihr im 35. Jahre Eures Alters sollt aufs Rad gelegt und durch den
Scharfrichter umgebracht werden, also hütet Euch davor und begeht keine
solche Händel, die einen solchen Lohn bringen sollen“. Hierüber erschrickt
Klimpt, nimmt seine Sachen besser in Acht und hält sich darnach drei Jahre
in Habelschwerdt auf und treibt einen Eisenhandel und führt ein ganz
ehrbares Leben. Im vierten Jahre begeht er wieder zwei Morde in Mähren,
worauf ihn sein Gewissen nagt, er an des Astrologen Worte gedenkt und
sich in Troppau freiwillig dem Gerichte stellt, wo er dann im Jahre 1475
in seinem 35. Lebensjahre erst mit Zangen zerrissen und dann aufs Rad
gelegt ward.
(S. Wedekind S. 221.)
Im Jahre 1597 sind etliche Pillweissen (Hexen) von Ober- und Niederharsdorf,
auch Droßky genannt, eingezogen und nachmals zu Glatz verbrannt
worden. Es hatte eine Magd ihre Frau verrathen, von der sie ihre Schelmerei
und Schmiererei gelernt hatte und auch mit ihr ausgefahren war.
Und da hat es sich zugetragen, daß die Magd zwar mit auf den Hexenplan
gekommen ist, aber ihre Zöpfe hat sie nicht Widersinnes um den Kopf
gelegt. Darum sind die andern Pillweissen alle auf sie zugefahren und
haben sie greulich zerkratzt, hätten sie vielleicht gar umgebracht, wenn nicht
ihre Frau auf sie geschrieen hätte, daß sie sich bald auf ihre Kleider setzen
solle, denn als sie solches gethan hat, haben sie dieselbe zufrieden gelassen
und sind von ihr weggefahren, also daß sie gar allein geblieben ist.
Als sie nachmals befragt worden, wer sie so zerkratzt hätte, hat sie
Alles bekannt, wie es ihr unter den Pillweissen oder Hexen ergangen, hat
dieselben genannt, worauf sie alle gefänglich eingezogen und verbrannt
worden sind.
(Nach Aelurius S. 230 c. Poetisch behandelt bei Wedekind S. 209 2c. und von einem
andern Verfasser ebd. S. 772 c.)
Im Jahre 1540 hat sich zu Neurode bei Glatz eine wunderliche Historie
zugetragen. Es hat nämlich dieses Gut ein gewisser Georg von Stillfried
besessen, der mit einer gewissen Rosina von Schaffgotsch aus Hedwigsdorf
verheirathet war. Derselbe hatte etliche Gäste auf das sogenannte festum
Pantaleonis oder Knoblauchfest gebeten und Alles stattlich darauf zugerüstet.
Aber die Gäste blieben länger aus, als er gedacht hatte, da ward der Junker
ungeduldig und sagte im Zorn: „Ei so kommen alle Teufel aus der Hölle,
wenn kein Mensch kommen will!“ Darauf geht er in die Kirche zur Predigt.
Unter der Predigt kommen fremde seltsame Gäste in den Hof geritten und
befehlen dem Knechte, er solle hin nach dem Junker gehen und ihm sagen,
er solle heimkommen, die Gäste, die er gebeten, seien gekommen. Der Knecht
zeigt's dem Junker an, dem wird angst und bange, er erinnert sich seiner
Rede, und fragt darauf den Pfarrer, was er thun soll. Der Pfarrer räth
ihm, er solle alsbald mit seinem Gesinde aus dem Hause weichen. Dies
ordnet der Junker an und indem Jedermann, Knecht und Mägde in Furcht
und Schrecken davoneilen, vergessen sie des kleinen Kindes, welches in der
Wiege schläft. Die Teufel fangen an zu fressen, zu saufen, zu schreien und
in allerlei wunderbarlichen Gestalten, als Löwen, Bären, Katzen, Wölfe 2c.
zum Fenster hinauszusehen, das Gebratene, die Fische und Anderes zu weisen,
daß es der Junker, Pfarr und Nachbar sehen. Indem fällt es dem Junker
ein und er fragt: „Wo ist das Kind?“ Kaum hat er das Wort ausgeredet,
siehe da trat ein langer, schwarzer, häßlicher Geist zum Fenster und
trug das Kind auf den Armen, gleichsam als wenn er es den Eltern weisen
wolle. Der gute Junker weiß nicht, wo er sich vor Angst und Schrecken
wegen seines lieben Kindes hinwenden soll, hatte aber einen alten getreuen
Knecht bei sich, den fragte er, was er thun soll. Der Knecht sagt: „Junker,
ich will mich dem lieben Gott empfehlen und im Namen des Herrn hingehen
und sehen, daß ich mit Hilfe Gottes dem Teufel das Kind nehmen möge.“
Der Junker ist damit wohl zufrieden. Darauf läßt sich der Knecht vom
Pfarrer segnen und mit den Andern über sich beten, geht in das Haus bis
vor das Gemach, worin die Teufel waren, knieet nieder und betet abermals
und befiehlt sich dem Schutze des Allerhöchsten, macht hernach die Thüre
auf und sieht da beisammen einen ganzen Haufen Teufel, die dasitzen, gehen,
stehen, kriechen und schreien: „Hui, hui! was willst Du hier, was willst
Du machen?“ Der Knecht geht schwitzend und schweigend und doch auf
Gottes Hilfe bauend getrost auf den Teufel zu, der das Kind trug und
spricht ihn mit Ernst an: „Hörst Du Teufel, gieb mir das Kind!“ – „Nein“,
spricht der Teufel, „das Kind ist mein, gehe hin zu Deinem Junker und
sage ihm, er soll selbst herkommen und das Kind holen.“ Darauf sprach
der Knecht: „Ich bin jetzo in meinem Beruf, darin mich Gott gesetzt hat,
und weiß, was ich darin thue, daß Gott, meinem Vater, dies angenehm ist;
deshalb nehme ich im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
h. Geistes jetzo das Kind von Dir und bringe es wieder seinem Vater!“
Darauf greift er zu, reißt das Kind vom Arme des Teufels und obwohl
die Teufel gegrunzt, gemurrt, geschrieen und gedräuet haben, ihn ihn Stücken
zu zerreißen, so ist er doch unbeschädigt davon gegangen und hat das Kind
seinem Herrn wieder zugestellt.
Mehrere Jahre später *), als bei dem Knoblauchfeste abermals viele
Gäste auf dem Schlosse zu Neurode versammelt waren, und nach der Mahlzeit
die Becher fleißig in der Runde gingen, kam auch die Rede auf den Teufelspuk,
worauf der Burgherr in tiefes Schweigen versank. Da brach Herr
Heinrich Stillfried, der Aeltere, auf Steine, in ein lautes Gelächter aus,
in welches mehrere der Tischgenossen dermaßen einstimmten, daß der ganze
Saal erbebte. Verwundert und fragend blickte der Burgherr um sich und
erfuhr nun, daß man sich damals nur in guter Absicht zur Ausführung
dieses außerordentlichen Scherzes vereinigt habe, um Herrn George für sein
gotteslästerliches Fluchen zu bestrafen und ihm dasselbe abzugewöhnen, worauf
dieser nach kurzem Bedenken seinen Freunden dankbar die Hand schüttelte,
und auch wirklich bei ihm Reue erfolgte, denn es hat der Ritter Georg
von Stund an seine üble Gewohnheit des Fluchens gänzlich abgelegt. Der
große Rittersaal im Schlosse zu Neurode, der im zweiten Stock nach Abend
zu gelegen ist, jetzt aber seine ursprüngliche Bedeutung als Saal verloren
hat, ist noch lange der Teufelssaal genannt worden.
(Nach Joseph Thamm, Chronik von Habelschwerdt S. 55, bei Wedekind S. 422)
Im Jahre 1640 ist ein Weib verklagt worden, daß sie einen vertrockneten
Menschen- oder Diebsdaumen bei sich trage, den ihr ein Scharfrichterknecht,
den sie beherbergt hatte, wegen gutem Glücke zugeworfen und
sich dafür Leinwand zu Strümpfen ausbedungen hatte. Der Finger mußte
dem Gerichte ausgeliefert werden.
1650 klagte die gesammte Töpferzunft gegen einen ihrer Mitmeister,
daß sein Weib einige geweihte Sachen beim Verkaufe der Töpfe gebrauche,
um dadurch einen größern Absatz ihrer Waare zu erwirken.
1651 verklagte Jemand eine Frau, daß sie ihm durch zauberische media
sein Vieh verderbt hätte, wessen er sie selbst ergriffen hätte, da sie vor
seinem Garten auf der Wegscheide einige verbotene Zaubereien, benenntlich
ein Seigetuch, worin kreuzweis ein Paar hundert Nadeln gesteckt, eingegraben
hatte, auch von ihm von Zeit zu Zeit einige mobilia borgen thäte und nun
mehr drei Jahre hintereinander ihm allezeit das junge Vieh weggestorben,
daher er einige Muthmaßungen trüge, gestaltsam dieses Unglück von ihr
hergekommen wäre; beschuldigte sie zwar nicht, dermaßen es ihm unmöglich
wäre, dies zu beweisen, daß sie eine Hexe sei, allein stellte solches in ihr
Gewissen.
(S. Wedekind S. 109.)
Das Dorf Neuendorf im Habelschwerdter Kreise in einer Schlucht des
Schneegebirges zeichnet sich durch ein überaus großes und prächtiges
Gotteshaus aus, welches an der Stelle der alten hölzernen, zu Ehren der h.
Margarethe 1560 aus Holz errichteten und seit 1640 aus Stein umgebauten Kirche
erbaut worden ist. (1703?) Eine zweite alte, neben der ebengenannten stehende,
verdankt ihre Erbauung dem Schulzen desselben Ortes. Derselbe hatte im
Jahre 1486 seine einzige Tochter Barbara im Walde verloren, daher gelobte
er, der h. Barbara eine Kapelle zu erbauen, wenn er sein Kind wiederfände.
Dies geschah; nach drei Tagen ward die Kleine mit Holzspähnen
spielend, lächelnd und gesund wiedergefunden. Der Vater erfüllte sein
Gelübde und erbaute die Kapelle.
Die vorhin gedachte größere neue Kirche soll aber auf folgende Weise
entstanden sein. Ein Fürst, der in türkische Gefangenschaft gerathen war,
that das Gelübde, der h. Jungfrau eine Kirche zu erbauen, wenn er seine
Freiheit wieder erlange. Dies gelang ihm und bei seiner Ankunft in Wien
entdeckte er dem Grundherrn von Mittelwalde sein Gelübde, sagte aber, er
wisse nicht, wo er dasselbe erfüllen solle. Da kam ihm der Graf (Althann)
mit dem Erbieten entgegen, daß dies auf seinen Gütern geschehen könne und
wirklich wählte nun der Fürst den Platz zu Neuendorf.
*) Dies nur bei Wedekind S. 212.
(Poetisch behandelt bei Wedekind S. 779.)
Der sogenannte Ottenstein bei Hansdorf soll der Wohnsitz einer hier
begrabenen Zauberjungfrau, die man bald für eine der Mägde Libussas, bald
für „eine von dem Tartarenheere zurückgebliebene Frau nennt, sein. Sie
soll sich jedoch nur alle hundert Jahre einmal sehen lassen.
Nach einer andern wahrscheinlichern Erzählung hätte hier zur Zeit des
30jährigen Krieges ein Bauer Namens Otto gewohnt, der vom Ertrage
seiner Viehwirthschaft gelebt habe. Der habe, als die Schweden dorthin
gekommen, seine Rinder gut versteckt gehabt, diese seien aber durch einen
Verräther nach deren Verstecke geführt worden und hätten sie fortgetrieben,
darüber sei der Mann so erbost worden, daß er selbst sein Haus in Brand
gesteckt habe und mit den Seinigen fortgezogen sei. Die Trümmer desselben
hätte das Volk „Otto's Steine“ genannt und später habe der ganze Berg
davon den Namen Ottenstein bekommen.
(Poetisch behandelt bei Wedekind S. 777.)
Bei Volpersdorf, einem schönen Dorfe an der Walditz, das bis ins
Eulengebirge hinaufreicht, liegt der Klingen- oder Quinga-Berg und auf diesem
die Ruinen eines alten Raubschlosses, welches am Ende des 15. Jhdts. zerstört
worden sein soll. In und unter demselben hatte sich später eine
Räuberbande angesiedelt, welche hier um so sicherer war, weil das Dorf damals
noch sehr klein und nur nach Westen hin das Thal angebaut, der obere
Theil aber durch dichten Wald und Morast so gut wie unwegsam war.
Des Sonntags fanden sich nun aber beim Tanz im Kretscham des Dorfes
plötzlich fremde Männer ein, die viel Geld aufgehen ließen und beim Trinken
und Tanzen immer die thätigsten waren. Nun hatte aber von den anwesenden
Dörflerinnen namentlich eine Magd aus der Mühle im Löwengrunde
die Augen der fremden Gäste auf sich gezogen, sie stellten ihr eifrig nach
und boten ihr vieles Geld, wenn sie mit ihnen in ihre Heimath, die sie
freilich nicht näher bezeichneten, gehen wolle. Das Mädchen aber traute
ihnen nicht, indem sie des vielen Geldes wegen, welches sie zeigten, in ihnen
Räuber vermuthete. Zwar hatte sich die Bande bisher stets gehütet, in der
nächsten Nähe ihres Schlupfwinkels selbst Verbrechen zu begehen, allein
schließlich war doch die Kunde von der Existenz einer solchen in dieser
Gegend bis ins Dorf gedrungen, und als nun die Magd ihrem Herrn ihre
Noth klagte, wie sie sich vor den zudringlichen Menschen nicht zu retten
wisse, da gab er ihr den Rath, sie solle den nächsten Sonntag, wenn sie
wieder zu Tanze gehe, scheinbar einwilligen und mit jenen fortgehen, er
werde sorgen, daß sie beobachtet, unbemerkt begleitet und ihren Verführern
entrissen werde. So geschah es auch, am nächsten Sonntage fanden sich
die Räuber aufs Schönste geputzt wieder ein, das Mädchen erhörte sie
diesmal, fand aber Gelegenheit, ehe sie zusammen fortgingen, einigen der
jungen Burschen, die bereits von der Unternehmung unterrichtet und deshalb
wohl bewaffnet gekommen waren, einen Wink zu geben. Diese folgten
ihrer Spur, welche, weil sie überall unterwegs Erbsen fallen ließ, leicht zu
finden war, durch Dick und Dünn und so langten sie denn plötzlich auf
dem Gipfel des Klingenberges an, wo sie sich plötzlich vor dem Gemäuer
einer alten Schloßruine sahen. Hier hörte aber die Spur auf, plötzlich
sahen die Verfolger aber, wie die Magd gleichsam um sich umzusehen aus
einem der offenen Fenster heraus schaute. Zwar ward sie sogleich von den
Räubern wieder zurückgezogen, allein die Verfolger hatten genug gesehen,
sie schlugen die Thüre ein, welche in das Innere der Burg führte und
von den Räubern doch nicht fest genug verrammelt war und überfielen die
nichts ahnenden Räubergesellen. Zwar widersetzten sich dieselben so gut als
möglich, allein die Uebermacht war zu groß, sie wurden überwältigt und
entweder getödtet oder gefangen genommen, das muthige Mädchen aber hatte
schon während des Ueberfalls Gelegenheit gefunden sich zu flüchten. Bei
dieser Gelegenheit ward jedoch Alles zerstört, was bis dahin noch von dem
Schlosse übrig gewesen war und jetzt sind eben nur noch wenige Spuren
davon übrig.
Unter den alten in Schutt versunkenen Burgen der Grafschaft Glatz
ist die Burg Hummel, auf einem gegen 1300 Fuß hohen Berge zwischen
den Städten Reinerz und Lewin, die berühmteste. Der erste Erbauer oder
Besitzer derselben soll ein Böhme, ein gewisser Homole gewesen sein und von
diesem die Burg ihren Namen erhalten haben. Jetzt sind allerdings nur
noch wenige Trümmer derselben übrig. Ums Jahr 1635 verbreitete sich
bei den Umwohnern allgemein die Sage, daß es in den Ruinen der Hummelburg
spuke, man brachte die in der Nähe derselben oft theils todt, theils
noch lebend, aber sehr zerkratzt gefundenen Personen auf die Rechnung des
Teufels und seiner Gesellen, und Leute, die aus Lewin in die Nähe der
Burgtrümmer kamen, um Pilze zu suchen, behaupteten hier öfters Bären
gesehen zu haben, was möglicher Weise in Thierfelle verhüllte Räuber
gewesen sein könnten. Indeß gehen verschiedene Sagen von diesem Orte.
*) Es soll einer der Nachkommen Homole's ein schlimmer wüster Geselle
gewesen sein, der all sein Hab und Gut verpraßte. Seine tugendhafte
Gattin, die ihn von seinem Treiben abmahnte, ward ihm bald zuwider und
so schaffte er sie heimlich durch Meuchelmord aus der Welt. Die zahlreichen
Kinder, welche sie ihm geboren hatte, wuchsen nun in Sünden auf, sie sahen
nur Böses und wurden daher bald so gottlos wie ihr eigener Vater. Derselbe
ward nach und nach zu einem förmlichen Wegelagerer und freute sich
des Namens „Raubgraf“, den ihm die ganze Nachbarschaft beilegte. Einst
sah er von den Zinnen der Burg auf der Straße drei Wagen angefahren
kommen, er witterte reiche Kaufmannsgüter in ihnen, brach mit seinen Mordgesellen
über sie her und führte sie, nachdem er ihre Begleiter erschlagen,
ins Schloß hinauf. Kaum dort angelangt, kamen seine Kinder herbeigeeilt
und Jeder beeiferte sich einen der wohl verschlossenen Kasten, welche die
Wagen enthielten, aufzubrechen, um sich der darin befindlichen Werthsachen
zu bemächtigen. Allein statt Gold und Silber entstiegen den Kisten geharnischte
Männer mit bloßen Schwertern, zwar versuchten die Söhne und
Knechte des Raubgrafen mit ihnen zu kämpfen, allein vergebens, ihre Schwerter
und Speere zersplitterten wie Spreu, es waren Geister, keine Menschen,
mit denen sie stritten. Plötzlich öffnete sich der Boden, Flammen kamen
hervor und die Burg versank mit allen, die darin waren, noch heute aber
hört man zuweilen an jener Stelle aus der Erde ein Geräusch wie das
Sumsen von Hummeln, das ist das Gestöhn der versunkenen Hummelschloßbewohner.
(Poetisch behandelt von A. Kypselos [Kastner] in seinen Glatzischen Sagen.
Breslau 1838 Bd. I. S. 7 c.)
Einst lebte zu Nerbotin bei Glatz ein armer Holzhauer, der sich mühsam
vom Holzfällen im Hummelthale ernährte. Derselbe konnte einstmals in
der Nacht nicht schlafen, ein gewisses Etwas trieb ihn aufzustehen und in
den Wald an seine gewohnte Arbeit zu gehen. Er begab sich also lange
vor Tage in den dichten Fichtenwald, welcher die Trümmer des alten
Hummelschlosses umgiebt, da stand auf einmal ein gespensterhaftes Weib in einem
weißen, mit Blut beflecktem Gewande, mit schwarzen fliegenden Haaren, ein
Schlüsselbund an der Seite und einen Dolch in den Händen, vor ihm.
Erschreckt schlug er ein Kreuz und sprach: „Alle guten Geister loben Gott
den Herrn!“ Die Gestalt aber antwortete: „Fürchte Dich nicht, ich will
Dir nichts zu Leide thun, im Gegentheil bitte ich Dich, mir zu helfen. Ich
bin der abgeschiedene Geist einer Edelfrau dort oben vom Schlosse. Ich
hatte ein Verhältniß mit einem benachbarten Ritter angefangen, mein Gatte
bekam Wissenschaft, wie jener eines Tages sich ins Schloß geschlichen hatte,
um mit mir eine Zusammenkunft zu haben, er ließ ihn festnehmen und in
den Kerker werfen, mir aber verzieh er unter der Bedingung, fortan der
Tugend treu zu sein. Ich versprach Alles, allein eines Nachts, als mein
Gemahl an meiner Seite schlief, stieß ich ihm diesen Dolch in die Brust,
eilte dann hinab zu dem Kerker meines Buhlen, öffnete selbst mit diesem
Schlüsselbund die Thüre des Gefängnisses, befreite ihn und lebte fortan in
Saus und Braus mit ihm, bis mich der Tod mitten in meinen Sünden
ereilte. Seit diesem Augenblicke kann ich nicht zur Ruhe eingehen, sondern
muß im Schooße dieses Berges meiner Erlösung harren, die Flecken von
dem Blute meines Gemahls und das Schlüsselbund in meiner Hand brennen
aber wie höllisches Feuer mein Gebein, und ich bitte Dich fußfällig, mich zu
befreien. Nur alle hundert Jahre ist dies möglich und diese sind jetzt gerade
um.“ Als nun der mitleidige Holzhauer sie fragte, wie er dies anfangen
solle, sagte sie: „In der nächsten Mitternachtstunde sei hier in diesem Thale,
da werde ich Dir in der Gestalt eines furchtbaren Drachen, das Schlüsselbund
im Rachen haltend, erscheinen. Das mußt Du mir trotz meines
scheinbaren Widerstandes zu entreißen suchen und mit diesem Dolche hier
mich durchbohren, daß mein schwarzes Blut fließt. Dann bin ich erlöst.
Laß Dich durch nichts erschrecken, ich werde Dir kein Leid anthun; kannst
oder willst Du dies nicht versuchen, muß ich wieder hundert Jahre umgehen
und auf einen neuen Befreier harren!“ Der Holzhauer versprach ihr mitleidig
zu kommen und den Kampf zu wagen, und da reichte sie ihm den
blutigen Dolch. In der Mitternachtstunde des nächsten Tages war er auch
richtig zur Stelle, als er aber den aus dem Dickicht hervorbrechenden, heiseres
Gezisch ausstoßenden und Feuer aus seinem ungeheuern Rachen ausspeienden
in ungeheuren Ringen auf ihn losstürzenden Drachen gewahrte, war auch
sein Muth dahin, er flüchtete in schnellen Sprüngen den Berg hinan, der Drache
hinter ihm her, als er aber jetzt vor Angst den Dolch fallen ließ, da geschah
ein furchtbarer Knall, und der Drache war verschwunden. Eine Stimme
aber rief: „Wiederum verloren!“ So sitzt die Unglückliche wohl jetzt noch
auf dem Grunde des Hummelberges und wartet auf einen Erlöser.
*) Ä erzählt von K. A. Müller, Burgen und Ritterschlösser Schlesiens.
Glogau 1844, S. 109.
(Poetisch behandelt von Kypselos (Kastner a. a. O. S. 151c.)
Es lebte einmal eine arme Wittwe mit einem einzigen Söhnchen in
einem Dorfe in der Nähe des Hummelberges, die nichts verdienen konnte
und bereits seit drei Tagen nichts mehr zu essen hatte. Es war gerade am
heiligen Christtag, sie wußte sich keinen Rath, wo sie etwas hernehmen solle,
da fiel ihr ein, daß einst noch bei Lebzeiten ihres Mannes ein Fremder bei
ihr eingekehrt war, den hatten sie nach besten Kräften gepflegt und gespeist
und zum Abschied hatte er ihr gesagt, im Schooße des Hummelberges lägen
große Schätze vergraben; in der Christnacht könne ein frommer, tugendhafter
und unverschuldet in Armuth gerathener Mensch dieselben heben, denn da
lägen sie offen da, wer aber unreines Herzens sei, der werde von furchtbaren
Schlangen verschlungen. Bis dahin hatte die Arme nie wieder an
diese Mittheilungen gedacht, jetzt aber, wo die Noth am größten war, dachte
sie doch, es sei besser den gefährlichen Weg zu gehen, als mit ihrem Kinde
zu verhungern. Sie machte sich also auf den Weg, indem sie ihren Knaben
in seinem ärmlichen Bettchen zurück ließ, da er eben eingeschlafen war, allein
noch war sie kaum wenige Schritte von ihrer Behausung entfernt, als sie
ihn ängstlich schreien hörte, ihre Mutterliebe erlaubte ihr nicht weiter zu
gehen, ohne nachzusehen, was dem Kinde fehle, sie kehrte also um und als
sie das Kind erwacht fand, nahm sie es auf den Arm, redete ihm zu und
suchte es durch das Versprechen, ihm Essen und Spielsachen geben zu wollen,
zu beruhigen. So gelangte sie denn mit ihrer Last auf beschwerlichem Schnee-
und Eispfade bis an den Fuß des Hummelberges. Da hörte sie es tief
unten im Grunde des Berges rauschen und dröhnen und sie sah denselben
unten auseinander bersten, sie aber scheute sich nicht, sondern stieg muthig
in die Tiefe hinab, hier trat ihr eine weiße Gestalt mit fliegenden schwarzen
Haaren, einen spitzigen Dolch und ein Schlüsselbund in den Händen, aber
sonst mit Blut befleckt aus dem Abgrunde entgegen. Sie ließ sich aber
nicht stören, setzte ihr Kind nieder auf die Erde und suchte sich nun die
zwischen Schutt und Steinen herum zerstreut liegenden Goldstücke auf.
Als sie genug in ihrer Schürze zusammengehäuft zu haben glaubte, stieg sie
wieder hinauf in die Oberwelt, indem sie beabsichtigte ihren Knaben nachzuholen,
denn um ja recht viel fortbringen zu können, hatte sie ihn einstweilen
unten gelassen. Aber ach, wie ward ihr, als es auf einmal drei schlug, die
Stunde, bei welcher sie wußte, daß der Berg sich wieder schließen mußte.
Und so geschah es auch, mit dem Schlage der Glocke dröhnte das Innere
des Berges und unter Blitz und Donner schloß sich der Schlund des Berges
wieder, sie aber sank auf ihre Kniee nieder und klagte sich jammernd als
Mörderin ihres Kindes aus schnöder Habsucht an. Verzweifelnd warf sie
die gesammelten Goldstücke weg und eilte wie von Furien gejagt durch Gestrüpp
und Moor nach ihrer Hütte zurück. Dort traf sie ihre Schwester
an, welche aus weiter Ferne gekommen war, um ihr Trost und Hilfe in
ihrer Noth zu bringen. Verzweifelt beichtete sie ihr, was sie gethan und
wollte ihrem Leben selbst ein Ziel setzen, allein diese sprach ihr Trost zu
und hieß sie Geduld haben bis zur Christnacht des nächsten Jahres, dann
solle sie noch einmal den Gang wagen, sie werde gewiß ihr Kind munter
und gesund wiederfinden. Da faßte sie wieder Hoffnung und gelobte sich
hoch und theuer, sie wolle entweder ihr theures Kind retten oder selbst in
dem Schlunde des Berges ihr Grab suchen. Und so verging unter Harren
und Bangen ein ganzes Jahr, und als die Christnacht endlich wieder herankam,
da stand auch die Wittwe zur Stunde wieder am Hummelberge und abermals
that sich das Innere desselben auf und siehe, tief unten auf dem Boden
saß ihr Knabe und hielt in seiner zarten Hand eine Frucht aus fremdem
Lande, die hatten ihm heilige Engel tagtäglich dorthin gebracht und ihn so
ein ganzes Jahr ernährt. Als ihr nun der Knabe harmlos entgegenlachte,
und sie ihn zärtlich in ihre Arme schloß und schnellen Laufes mit ihm aus
dem Berge hinauseilte, da schien auch das Gesicht des Hummelweibes,
welches wiederum bei den Schätzen erschien, freundlicher und milder zu blicken,
und wie sie auch die Goldstücke am Boden anlachten, sie rührte keines an,
sondern ließ Schätze Schätze sein und eilte frohen und dankerfüllten Herzens
ihrer Heimath zu. Seit der Zeit soll noch Mancher in der Christnacht sich
in den Hummelberg gewagt haben um Schätze zu finden, allein herausgebracht
hat. Niemand etwas, denn der Eine war nicht fehlerrein, der Andere
aber nur zum Schein arm.
(Poetisch behandelt von Kypselos (Kastner] S. 1 c.)
Wenn man die Gipfel des Schneebergs erstiegen hat und von da den
hohen Fall der Wölfel betrachtet, da sieht man auf dem nördlich von der
Habel aufsteigenden Hügel fünf Felsen, welche sich grau und baumhoch in
die Luft thürmen, die jede Minute den Einsturz zu drohen scheinen. Ihr
Ursprung soll aber folgender sein.
Einst graste an dem Abhange des Berges tagtäglich eine Rinderheerde,
gehütet von vier Knaben. Dieselben trieben sich den ganzen langen Tag
hier herum, machten aber nichts als böse gottlose Streiche und erfüllten die
ganze Umgegend mit ihrem wüsten Geschrei. Einst waren sie auch da und
es war die Zeit gekommen, wo sie Mittag machen sollten. Ihr Vater aber
hatte ihnen nur hartes, schimmliges, trockenes Brod mitgegeben und dieses
war ihnen zu schlecht, da nahmen sie es, warfen es auf die Erde, traten
mit Füßen darauf herum und spuckten darauf. In der Nähe pflügte ein
Bauersmann, er sah den Frevel, hörte ihre gottlosen Verwünschungen, aber
es rührte ihn nicht, kein Wort der Mißbilligung kam aus seinem Munde,
im Gegentheil er lachte darüber. Da umzog sich auf einmal der Himmel,
es ward schwarze Nacht und aus den zu Bergen aufgethürmten Wolkenmassen
zischten feurige Blitze herab und eine furchtbare Stimme erscholl und
rief: „Ihr Sünder und Du böser Mann, werdet zu Steinen, und lehrt
als Steine der Nachwelt, daß Niemand straflos freveln darf!“ Als aber
das Unwetter sich wieder verzogen hatte und die Sonne wieder in ihrer
Klarheit aus den Wolken hervortrat, da waren die Knaben und der Bauersmann
verschwunden und an der Stelle, wo sie vorher gestanden und gefrevelt,
sah man jetzt fünf graue Felsenmassen. Sie waren zu Stein geworden.
Das sind die sogenannten Hirtensteine.
(Romantisch behandelt von Kypselos S. 86–109.)
Vor langen Jahren lebte ein reicher Müller zu Jauernick bei Lewin
in der Grafschaft Glatz. Derselbe hatte eine einzige Tochter, die sehr schön
war und in die sich ein armer Müllerbursche, den der Alte aus Gnade und
Barmherzigkeit zu sich genommen hatte, verliebt hatte. Das Mädchen sah
ihn aber auch gern und so versprachen sich denn die beiden Leutchen mit
einander und meinten, der Vater werde am Ende auch zu ihrem Herzensbund
sein Ja sagen. Sie traten also schließlich zusammen vor ihn hin
und öffneten ihm ihr Herz, allein sie hatten zuviel auf die väterliche Nachsicht
gebaut, der alte Müller hatte Anderes mit seiner Tochter im Sinne, der
arme Müllerbursche war ihm zu schlecht, und so hieß er ihn denn seines
Weges ziehen und seine Tochter in Ruhe lassen. Als nun aber das Mädchen
ihm unter Klagen und Weinen um den Hals fiel und versicherte, daß sie
ohne den Burschen nicht leben könne und lieber sich das Leben selbst nehmen
als einen Andern ehelichen wolle, da ward der Alte doch etwas gerührt und
er sagte als sein letztes Wort, jetzt dürften sie sich allerdings noch nicht
heirathen und der Jacob müsse auch aus dem Hause, allein wenn er nach
drei Jahren mit soviel Geld in der Tasche wiederkehre, als nöthig sei, um
den halben Kaufpreis seiner Mühle zu bezahlen, da solle er seine Tochter
zur Frau haben, sei aber diese Frist vorüber und er sei nicht wiedergekehrt
oder habe nicht wenigstens die verlangte Geldsumme aufzuweisen, sei sie für
immer für ihn verloren. Dagegen war nichts zu sagen, der Müllerbursche
schnürte sein Bündel und zog voll guter Hoffnung hinaus in die Welt, denn
er dachte sich in den drei Jahren, die er noch vor sich hatte, wohl soviel
ersparen zu können, als sein künftiger Schwiegervater verlange. Und bereits
war das dritte Jahr fast abgelaufen und er hatte wirklich so viel zusammengebracht,
als ihm zur Erreichung seines höchsten Wunsches nöthig schien und
er war schon auf der Rückreise nach seinem Heimathsdorfe, da trug es sich zu,
daß er von langer Wanderung todtmüde sich in einem Gebüsche am Rande
der Heerstraße niederwarf und in einen tiefen Schlummer sank. Da kam
desselben Weges ein lüderlicher Strolch gezogen, als der auf dem Rasen
den schlummernden Handwerksburschen gewahrte, da dachte er, es könne
wohl sein, daß er ein Paar Sparpfennige in seinem Ränzel habe, er schlich
sich an ihn heran und öffnete ohne Geräusch das Felleisen und als er dasselbe
wohl gespickt mit schönen Goldstücken sah, da stahl er sie heraus und
schlüpfte durch das Gebüsch auf Nimmerwiedersehen davon. Als aber der
arme Müller endlich erwachte, da sah er die Bescherung, sein Felleisen lag
aufgebrochen neben ihm, aber all sein mühsam erspartes Eigenthum war
dahin und mit demselben auch seine Hoffnung seinen Schatz je sein nennen
zu dürfen. Was half aber alles Jammern und Weinen, hier konnte er
doch nicht bleiben, dem Diebe, den er nicht kannte, konnte er auch nicht
nachlaufen und so mußte er sich denn auf die Socken machen und eilen,
ein Nachtlager zu bekommen. Er schritt also mit leichtem Ranzen, aber
schwerem Herzen fürbaß und kam spät am Abend an die Thore Wiens,
mußte aber natürlich in einer elenden Herberge Einkehr nehmen, denn Geld
hatte er so gut wie gar nicht mehr, um sich einen bessern Aufenthalt suchen
zu können. Als er nun in der Stube des Wirthshauses traurig bei seinem
kärglichen Abendbrode saß, da sah er, daß drei fremde Männer, welche ihm
wie Welsche vorkamen und an einem andern Tische saßen und lustig zechten,
ihn aufmerksam anblickten. Endlich redeten sie ihn an, tranken ihm ein
Glas heurigen zu und hießen ihn aus ihrer Weinkanne Bescheid thun. Anfangs
wollte er zwar nicht recht daran, aber Zureden hilft und als er einige
Gläser des feurigen Oberösterreichers getrunken, da wurde er gesprächig
und erzählte den Fremden, was ihm Trauriges begegnet war. Da meinten
sie, es wäre wohl möglich, daß sie ihm helfen könnten, er müsse natürlich
aber auch seinerseits ihnen einen Gefallen thun. Sie fragten ihn, ob er
nicht, da er bei Lewin im Glatzer Lande zu Hause sei, den sogenannten
goldenen Stollen kenne. Er antwortete, diesen kenne er allerdings, er liege
nicht weit von seinem Heimathdorfe, am Fuße der hohen Mense und in
der Nähe der Seefelder, es sei ein Felsen, der einen großen Spalt habe,
in welchem der Sage nach große verwünschte Schätze verborgen lägen. Sie
fragten ihn nun, ob er sie wohl dorthin führen könne. Der Müller antwortete,
das könne er wohl, wenn sie aber etwa gedächten, die dort liegenden
Schätze heben zu wollen, so möchten sie sich dies nur vergehen lassen, das
hätten schon Viele versucht, aber gelungen sei es noch Keinem. Da meinten
aber die Welschen, das sei ihre Sorge, sie verlangten von ihm nur, daß er
ihr Führer sei, wenn er sie hingebracht, würden sie schon selbst fertig werden,
ihm sei reicher Lohn gewiß. Damit hießen sie ihn sein Strohlager suchen
und er mußte ihnen versprechen, sich am andern Morgen nicht ohne sie entfernen
zu wollen.
Jacob wurde am nächsten Tage durch eine eisige Kälte aufgeschreckt,
welche seine Glieder krampfhaft schüttelte. Er selbst sah sich aus der Herberge,
wo er schlafen gegangen war, ins Freie versetzt, er lag auf der kalten
Erde, welche mit niedrigem Moose und spärlichem Grase bedeckt war. Er
sprang ängstlich in die Höhe und sah sich zuerst nach seinem Ränzel um,
von dem er wußte, daß er es am Abend zuvor unter seinem Kopfe gehabt
hatte. Allein kein Ränzel war zu sehen und in demselben Augenblicke fiel
ihm ein, daß möglicherweise die drei Fremden es ihm, so wenig es auch noch
enthielt, gestohlen haben könnten. In dieser Vermuthung ward er aber um
so mehr bestärkt, als er die Welschen selbst nicht sah, von denen er doch
wußte, daß sie am Abend zuvor noch neben ihm auf dem Strohe gelegen
hatten. Er fing also an laut über sein Mißgeschick zu klagen und über die
treulosen Räuber, für welche er die Fremden hielt, zu fluchen. Mittlerweile
aber wurde es heller Tag und die feuchten Nebel, welche bis dahin die
Gegend umhüllt und eine Aussicht in die Thäler und Ebenen von dem hohen
Standpunkt, wo der Müller sich befand, verhindert hatten, senkten sich in
die Tiefe und plötzlich verstummte er vor Verwunderung, er erkannte die
Gegend wo er sich befand, er war nicht mehr in Wien, sondern in seiner
Heimath, am Fuße des Berges sah er aus dunkeln Gebüschen einzelne Teiche
im Lichte der Sonne heraufglänzen, er stand auf der hohen Mense, da
unten lagen die Seefelder und dort war das Böhmerland. In demselben
Augenblick aber traten hinter einer Felswand die drei Welschen hervor und
hießen ihn guten Muthes sein, denn sie wollten ihm sein mageres Ränzel,
welches sie bei ihrer Reise auf ihren Mänteln durch die Luft verloren hätten,
zehnmal ersetzen. Nur solle er sein Versprechen erfüllen und sie nach dem
goldenen Stollen führen. Jacob faßte aber jetzt Vertrauen zu den Fremden,
denn er sah, daß sie mehr konnten als Brod essen, und er hieß sie also ihm
folgen und so führte er sie denn auf einem allerdings sehr beschwerlichen
Wege bis an einen mächtigen Felsen, über welchen sich ein kleines Bächlein
in die Tiefe herabstürzte. An diesem konnte man deutlich eine weite, an den
Rändern mit feuchtem Moose bewachsene Qeffnung wahrnehmen. Diese bezeichnete
er ihnen als den Eingang zum goldenen Stollen und verlangte
nun aber auch die Bezahlung für seine Führerschaft. Die Fremden aber
meinten, er solle seinen Lohn schon bekommen, wenn das Werk vollbracht
sei, er möge doch aber selbst mit hinab in die Eingeweide des Schachtes
steigen, es sei keine Gefahr dabei, er solle ihnen nur folgen und das thun,
was er sie thun sähe, aber bei Leibe kein Wort sprechen.
Zwar war diese Verzögerung Jacob eigentlich nicht recht, allein da er
sich überlegte, die Fremden könnten, wenn er nicht mitgehe, vielleicht gar
durch einen andern ihm nicht bekannten Ausgang den Berg wieder verlassen
und er somit seines gehofften Lohnes verlustig gehen, so könne er aber vielleicht
selbst noch einiger Goldklumpen theilhaftig werden, er beschloß also den Hinabgang
mit ihnen zu wagen und versprach ihnen mitzugehen. Nachdem sie
nun eine kurze Weile am Fuße des Felsens gerastet hatten, um sich von
ihrem angestrengten Marsche zu erholen, fällten sie einen hohen Baum mit
vielen Aesten, hieben dieselben bis auf einen Zoll vom Stamme weg, schleppten
ihn nach dem Felsen und ließen ihn dann durch die Oeffnung desselben
hinab. Nun stiegen sie an den Astresten wie auf den Sprossen einer Leiter
hinab und befanden sich bald in einer ziemlich geräumigen Höhle, die sich
nach oben zu immer mehr verengte und nur ein schwaches Dämmerlicht durch
die Oeffnung nach außen erhielt. Nach keiner Richtung war aber eine Fortsetzung
oder Ausgang dieses von vier kahlen Felsenwänden gebildeten Gemaches
wahrzunehmen. Einer der Welschen nahm nun ein schwarz eingebundenes
Buch aus seiner Tasche, zündete eine schwarze mitgebrachte Kerze
an und fing an aus demselben eine sonderbar klingende Beschwörungsformel,
von der aber der Müllerbursche keine Sylbe verstand, vorzulesen. Als er
einige Worte gesprochen hatte, öffnete sich auf einmal die eine Seite der
Felswand und man gewahrte eine dicke eiserne Thüre, da las der Welsche
wiederum einige Worte aus dem Buche und auch diese Thüre sprang auf
und nun zeigte sich auf einmal ein langer schmaler Gang. In diesen traten
jetzt die vier Männer ein, schritten einige Minuten in demselben fort und
standen auf einmal vor einer zweiten eisernen Thüre. Hier fand genau
dasselbe Verfahren statt, nachdem einer der Fremden einen Spruch aus dem
Zauberbuche gelesen, sprang auch diese Thür auf und nun zeigte sich abermals
ein Gang, der hinten von einer dritten Thüre geschlossen ward. Vor
dieser lag aber ein ungeheurer schwarzer Hund, der die Kommenden mit
feurigen Augen anglotzte. Der Beschwörer aber ließ sich von ihm nicht
stören, sondern las abermals einige Beschwörungsformeln aus dem bewußten
Buche und das Unthier schlich willig zur Seite, legte sich ruhig hin und
schloß die Augen. Dann trat jener einige Schritte vorwärts, wiederholte
sein Verfahren und auch die dritte Thüre wich vor der Macht seiner
Beschwörungsformel. Nun traten sie in ein langes geräumiges Gemach, von
dessen Decke goldgelbe Zapfen herabhingen, welche den Schimmer der Kerze
zurückstrahlten und eine auffallende Helligkeit verbreiteten. In einer Ecke
waren jedoch die Wände ganz schwarz, und hier saß auf einem Haufen
dicker Goldklumpen ein eisgrauer Mann in uralter Tracht mit langem Barte
in tiefem Schlafe, sein rechter Arm, der eine Axt hielt, hing schlaff herab.
Ohne sich an den Alten zu kehren zogen nun die Welschen aus ihren Manteltaschen
Handbeile heraus, schlugen eine Menge der goldenen Zapfen herab,
konnten aber doch den Schläfer trotz des Lärmes, den diese Arbeit machte,
nicht erwecken. Mit diesen abgeschlagenen Zapfen füllten sie vier mitgebrachte
Säcke an, von denen jeder von ihnen einen auf die Schulter nahm,
den vierten aber packten sie Jacob auf. Darauf verließen alle die
Schatzkammer, der Welsche aber mit der Kerze machte den Beschluß. So wie
sie hinausgetreten waren, schloß sich auch die eiserne Thüre hinter ihnen, der
schwarze Hund sprang aus dem Winkel hervor und legte sich knurrend wieder
vor die Thüre, ebenso schnell sprangen dann auch die zwei andern eisernen
Thüren auf, schlugen aber eben so schnell wieder zu, sobald die vier hindurch
waren. Als sie nun schließlich wieder in die erste Höhle gelangt waren,
bis wohin sie den Baumstamm hinabgelassen hatten, da hatte sich auch die
Oeffnung in dem Felsen wieder geschlossen, welche zuerst die eiserne Thüre
zugänglich gemacht hatte und jetzt, nachdem die Kerze ausgelöscht worden
war, da ließen sie auch wieder ihrer Zunge freien Lauf und lobten den Müller
wegen des von ihm bewiesenen Muthes. Auf seine Frage, wer denn der
schlafende Alte gewesen sei, erfuhr er, daß dies ein früherer Schatzgräber
gewesen, der aber etwas bei seinem Unternehmen versehen hatte und nun
dort ewig schlafen müsse. Ein gleiches Loos hätte natürlich sie auch treffen
können. Jetzt erkannte der Müller erst, in welcher Gefahr er gewesen. Nun
hatten sie jedoch noch ziemlich viel Mühe damit, die schweren Säcke über die
Aeste des Baumstammes ins Freie zu bringen, allein endlich brachten sie
auch noch dies zu Stande und als sie nun außerhalb des Schachtes waren,
da überredeten die Welschen den Müller, er möge ihnen auch den Sack, den
er mit aus der Schatzkammer genommen, überlassen, denn er könne doch
mit den darin befindlichen Goldzapfen, als verwünschtem Golde nichts anfangen,
sie wollten ihm 300 Dukaten, die sie gerade bei sich führten, dafür
geben, diese Summe werde jedenfalls, hinreichen seinen zukünftigen Schwiegervater
zufrieden zu stellen. Was wollte Jacob machen, die Goldzapfen hätte er
doch nicht einschmelzen können und sie zu verkaufen fürchtete er sich, denn er
dachte, man werde fragen, wo er sie her habe. Er nahm also das Geld
und führte die Welschen wieder nach der hohen Mense, wo sie sich vor
seinen Augen auf ihre Mäntel setzten und auf und davon fuhren. Er aber
eilte jetzt ohne einen Augenblick zu verlieren querfeldein über Stock und
Stein, über Berg und Thal, durch Wald und Moos geraden Wegs in die
Mühle zu seiner Geliebten, und als er in die niedrige Stube trat, wo sein
zukünftiger Schwiegervater gerade mit seiner Tochter bei Tische saß, da
warf er die 300 Goldstücke, die er von den Welschen bekommen, hin auf
die Erde und rief: „Hier ist der Preis für Euere Tochter, ich habe mir
das Geld sauer genug verdient, nun haltet auch Ihr Euer Wort!“ Der
Müller aber sprach: „Auch ohne dieses Geld wärest Du mir willkommen
gewesen und hättest mein Mädchen zur Frau bekommen, denn ich habe sie
aus Sehnsucht nach Dir von Tage zu Tage hinwelken sehen, und da hat
mir das Herz weh gethan und ich habe mir gelobt, daß ich sie Dir auch
wenn Du ganz arm zurückkehren würdest, freudig zum Weibe geben wolle.“
So wurden Beide doch noch ein glückliches Ehepaar.
Quelle: Sagenbuch des Preußischen Staats. von Dr. Johann Georg Theodor Graesse. Zweiter Band. Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1871. (S. 196-212)
Standort: Staatsbibliothek Bamberg, Signatur: L.g.o.987-g(2
Digitalisat: Bayerische Staatsbibliothek München, Kein Urheberrechtsschutz (CC0 1.0 Universell)
www.digitale-sammlungen.de/de/details/bsb11723629
|
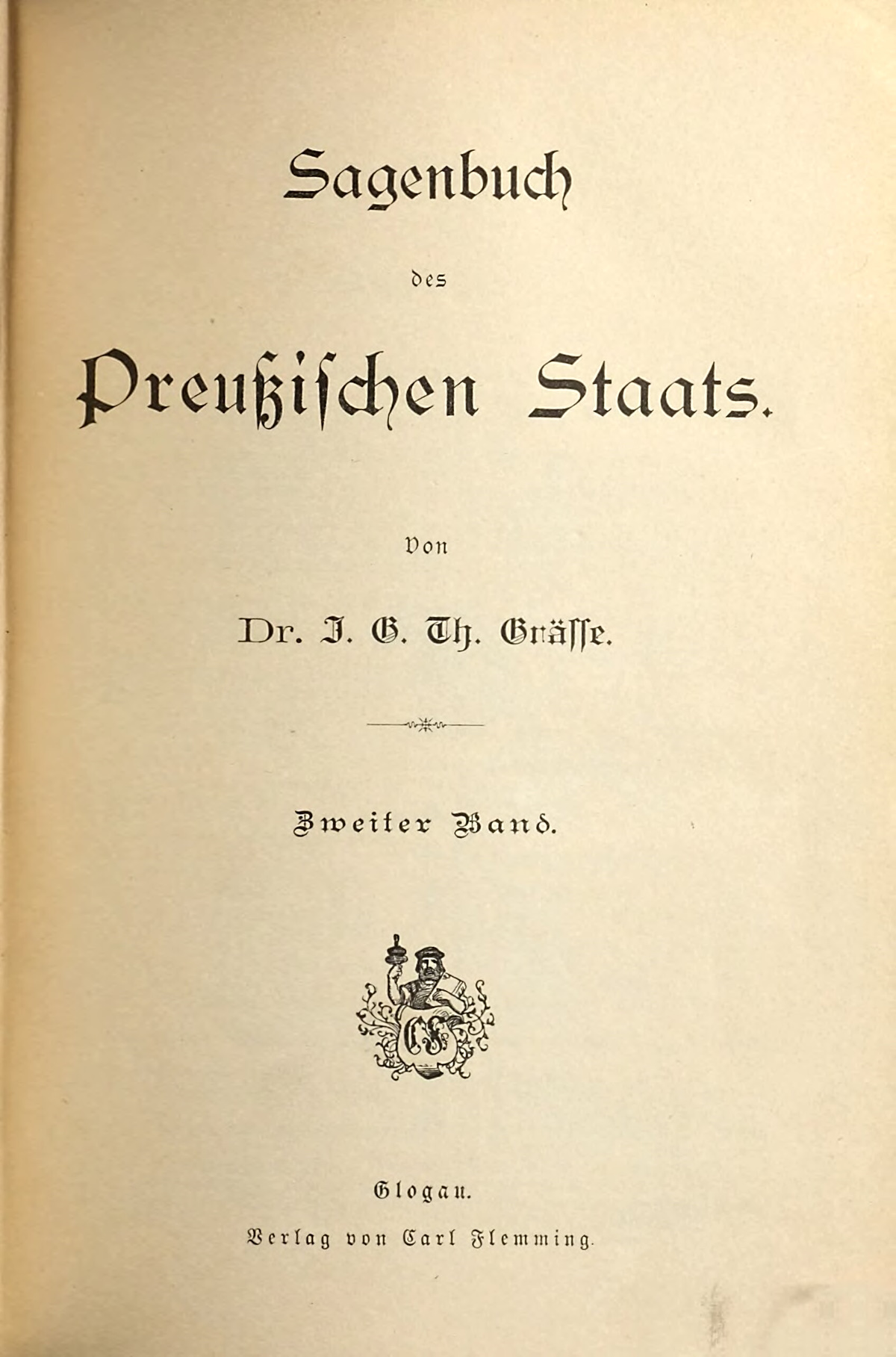

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Zurück zum Inhaltsverzeichnis